Wenn Geld, Personal, Medikamente fehlen: Das erschöpfte Gesundheitssystem

Text: Cornelia Ritzer
Illustrationen: Lena Jansa
Vertreterinnen und Vertreter von Bund, Ländern und Gemeinden treffen sich, um übers Geld zu sprechen: Das ist der Finanzausgleich. Die Wünsche, was mit den aktuell rund 90 Milliarden Euro Steuergeld finanziert werden soll und muss, sind immer vielfältig – und werden nach der Pandemie und angesichts der hohen Inflation und Teuerung sowie notwendiger Anpassungen an den Klimawandel noch dringlicher formuliert. Im Fokus der Verhandlungen, die kurz vor Weihnachten 2022 gestartet sind und bis kommenden Herbst dauern werden, stehen die Themen Gesundheit und Pflege. Darüber, wie diese für die Menschen so wichtigen Bereiche nachhaltig finanziert werden können, zerbrechen sich Politik sowie Expertinnen und Experten den Kopf.
Klar ist: Das österreichische Gesundheitssystem gilt als eines der besten in Europa. Die Menschen können mit Problemen zur Hausärztin und zum Hausarzt gehen, diese überweisen bei Bedarf an Spezialisten. Und die Krankenhäuser bieten eine breite Palette von Leistungen und moderne Technologien. Aktuell zeigt sich jedoch deutlich, dass das Gesundheitssystem unter Druck ist, nicht wenige sprechen von einer Krise.
Hilferufe aus den Spitälern
Die Lage ist alarmierend: Im April 2023 wurde öffentlich, dass knapp zehn Prozent der Betten in Oberösterreichs Krankenhäusern gesperrt sind – wegen Personalmangel. Das sind in absoluten Zahlen 720 Spitalsbetten, die nicht für Patientinnen und Patienten zur Verfügung stehen, weil nicht genug Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegekräfte im Dienst sind. Der Österreichische Gesundheits- und Krankenpflegeverband (ÖGKV) hatte kurz zuvor Alarm geschlagen und gewarnt: „Das Gesundheitssystem bricht zusammen.“ Anlass für diese drastische Formulierung war, dass zwei Patienten zu lange auf die Versorgung in einer Notfallambulanz hatten warten müssen und verstorben waren – vom Personal vorerst „unbemerkt“, wie es hieß.
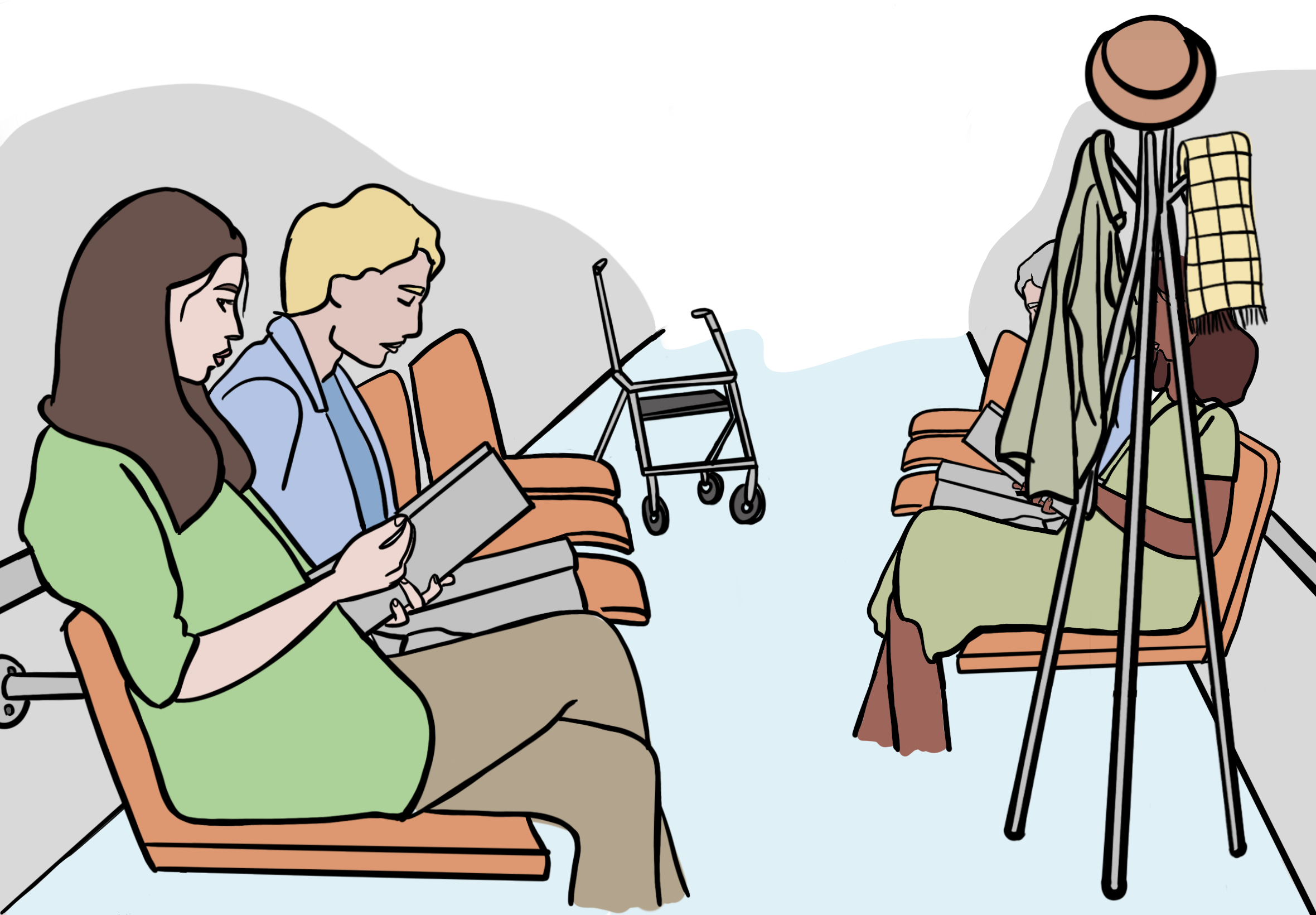
Das Gesundheitssystem steht unter Druck. Wie es verbessert und dauerhaft finanziert werden kann, ist derzeit Thema bei den Finanzausgleichsverhandlungen.
Doch nicht nur die Beschäftigten fehlen im Gesundheitssystem, auch wichtige Medikamente sind in jüngster Zeit wegen Produktionsproblemen, fehlender Rohstoffe oder Exportbeschränkungen häufig knapp geworden. Laut einer Marketagent-Umfrage Ende Jänner 2023 hat mindestens jede sechste Person in Österreich selbst oder im Umfeld die Erfahrung gemacht, dass ein Medikament nicht erhältlich war. Dass Antibiotika, Schmerzmittel, Krebsmedikamente und Co. knapp sind, beschäftigt laut Umfrage vor allem die weibliche Bevölkerung: Vier von zehn Frauen machen sich sehr oder eher große Sorgen deswegen.
Wie verlässlich ist also die medizinische Versorgung in Österreich? Das fragen sich viele. Der im September 2022 präsentierte Austrian Health Report des Instituts für empirische Sozialforschung (IFES) untermauert das mit Zahlen. Demnach sind 56 Prozent der Bevölkerung „zufrieden mit dem Gesundheitssystem“. Das ist zwar die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher (befragt wurden im Auftrag des Pharmaunternehmens Sandoz 800 in Österreich lebende Personen ab 18 Jahren, telefonisch und online), das Ergebnis sei aber überraschend, sagt IFES-Geschäftsführer Reinhard Raml. Aus Studien der vergangenen Jahre kenne man nämlich eine höhere Zufriedenheit mit dem Gesundheitssystem, so der Sozialforscher: „In Österreich haben wir eine gute Versorgung, und wir sind es gewohnt, dass diese auch für alle funktioniert.“
Reinhard Raml, IFES-Geschäftsführer
Doch nun seien „etliche Fragezeichen aufgetaucht“, etwa die Verschiebung von OP-Terminen, der sichtbar gewordene Personalmangel oder die Schwierigkeit, eine Ärztin oder einen Arzt zu finden, die oder der noch neue Patientinnen und Patienten aufnimmt. Das beschäftige die Menschen, meint Raml. Auch die Engpässe bei der Verfügbarkeit mancher Medikamente seien ein Grund, warum die bisher immer große Zufriedenheit der Österreicherinnen und Österreicher mit dem Gesundheitssystem stark leidet. „Diese hohe Dynamik beobachten wir seit etwa drei Jahren“, erklärt der IFES-Geschäftsführer. Ob und wann „Ruhe einkehrt“, werde man weiter beobachten.
Verschiedene Zuständigkeiten
„Wir haben tatsächlich ein sehr gutes Gesundheitssystem“, sagt die Ökonomin Maria M. Hofmarcher-Holzhacker. „Denn die Wahrscheinlichkeit, dass in Österreich schwere Erkrankungen dank des Gesundheitssystems überlebt werden, ist sehr hoch.“ Probleme würden sich bei chronischen Krankheiten oder beim Bedarf an langfristiger Betreuung ergeben: „Diese Versorgung kann nicht in dem Umfang geleistet werden, wie es oft notwendig und am kostengünstigsten wäre.“ Problematisch sei vor allem die Finanzierung des Systems, so Hofmarcher-Holzhacker.
Die Expertin für Gesundheitspolitik und Gesundheitssysteme spricht damit eine Struktur an, die von geteilten Zuständigkeiten geprägt ist. So ist der Bund für die Gesundheitspolitik insgesamt und für das Grundsatzgesetz für die Spitäler zuständig, wesentliche Bereiche der Gesundheitsversorgung liegen in
der Kompetenz der Länder. Sie vollziehen die Ausführungsgesetze für Spitäler und sind für die Pflege verantwortlich, und die Sozialversicherung nimmt die Bereitstellung von Vertragsleistungen im
niedergelassenen Bereich, von Medikamenten und Heilbehelfen sowie von Rehabilitation wahr.
Dieses Zusammenspiel von Bund, Ländern – die Hofmarcher-Holzhacker als „sehr starke und autonome Player“ beschreibt – sowie der für die Kassenmedizin zuständigen Sozialversicherung verläuft naturgemäß nicht reibungslos. Hofmarcher-Holzhacker: „Seit Jahrzehnten haben wir das Problem, dass die Akteurinnen und Akteure in ihren Silos der Zuständigkeit agieren.“ Eine Folge davon sei, „dass viele Patientinnen und Patienten im Dschungel der Zuständigkeiten herumirren und oft keine adäquate Versorgung finden oder einen Behandlungstermin bekommen“. Und: Trotz zahlreicher Reformen und Bemühungen in den letzten 20 Jahren werde „dieses strukturelle Problem seit Jahren nicht gelöst“.
Ineffizienzen als Problem
Das sei vor allem deshalb schade, sagt die Expertin, weil Österreich auch im internationalen Vergleich sehr viel Geld für Gesundheit ausgibt. Laut Statistik Austria (Stand: 2021) fließen jährlich 38,48 Milliarden Euro in Österreichs öffentliches Gesundheitssystem. Pro Kopf belaufen sich die Gesundheitsausgaben auf 4.100 Euro, damit liegen wir EU-weit an dritter Stelle. Die durchschnittlichen Ausgaben in Europa betragen 3.200 Euro. „Das ist auch in Ordnung so, denn Österreich ist ein reiches Land. Aber wir erzielen nicht die Ergebnisse, die man sich bei diesen hohen Ausgaben erwarten würde“, sagt Maria M. Hofmarcher-Holzhacker. Es bestünden „verschiedene strukturelle Probleme“ im Gesundheitssystem, etwa bei der Diabetesversorgung.
Maria M. Hofmarcher-Holzhacker, Ökonomin
Wie sehen diese Ineffizienzen konkret aus? 2013 wurden im Rahmen der partnerschaftlichen Zielsteuerung nach der die Gelder aus Bund, Ländern und Sozialversicherung zur gemeinsamen Steuerung des niedergelassenen und des Spitalsbereichs virtuell zusammenfließen – Indikatoren entwickelt, anhand derer überprüft werden soll, ob bestimmte Versorgungs- und Qualitätsziele erreicht werden. Bund, Länder und Sozialversicherungsträger arbeiten also nicht nur bei der Finanzierung zusammen, sondern sollten sich auch bei der Umsetzung gegenseitig unterstützen. Dazu gehört der Ausbau des niedergelassenen Bereichs, der günstiger als Spitäler arbeitet und die erste Anlaufstelle für Patientinnen und Patienten ist.
Das Monitoring der Zielsteuerung sei „ganz gut gelungen“, so Hofmarcher-Holzhacker. Seit 2013 gilt aber auch ein Kostendämpfungspfad, der die Ausgaben am angenommenen BIP-Wachstum orientiert und damit Mehrausgaben zur Finanzierung des Gesundheitssystems einschränkt. „Dieser Kostenpfad wurde 2017 noch einmal festgezurrt“, erklärt die Gesundheitsökonomin. Das Gesundheitssystem habe sich an den Pfad gehalten, jedoch mit der Folge, „dass ihm Mittel entzogen wurden und es eine Unterfinanzierung gibt, weil der Kostenpfad nicht berücksichtigt, was der Versorgungsbedarf ist und welche Mittel für den technischen Fortschritt notwendig sind, um eine hochqualitative Versorgung weiterhin allen zu bieten. Und das kritisiere ich sehr.“
Maria M. Hofmarcher-Holzhacker hat Grundlagen für diesen Kostenpfad entwickelt, erzählt sie: „Ich dachte, das ist eine gute Möglichkeit, dem Gesundheitswesen Mittel zuzuführen und trotzdem nachhaltig zu bleiben.“ Heute sieht sie ihn kritisch. Zwar könne man „nicht endlos Geld ausgeben für Gesundheit, aber dass man die Finanzierung dumpf an die Entwicklung der Wirtschaftsleistung bindet, war ein Fehler. Und den muss man korrigieren.“ Der Finanzausgleich sei nun ein „Fenster“ für die Gestaltung eines „großzügiger ausgestatteten Kostenpfads“. Ein solcher sei nötig, um die künftigen Herausforderungen zu meistern – etwa eine immer älter werdende Gesellschaft, aber auch die durch Zuwanderung wachsende Bevölkerung.
Frauen als Stützen der Branche
Die Gesundheitsökonomin betont zudem den Wertschöpfungsbeitrag, den der Bereich Gesundheit für die Wirtschaft leisten könne, dieser werde jedoch „systematisch ignoriert oder unterschätzt“. Hofmarcher-Holzhacker: „Wir müssen erkennen, dass wir einen Bereich haben, der viel Geld kostet, aber strategisch bedeutsam ist, weil er Beschäftigung – vor allem von Frauen – sichert.“ Dazu brauche es aber auch Investitionen und gute Gehälter für Frauen, deren Anteil im Gesundheits- und Sozialwesen 64 Prozent beträgt: „In keinem anderen Bereich sind die patriarchalen Strukturen so spürbar. Ich bin dafür, dass die nichtmedizinischen Beschäftigten im Gesundheitswesen und vor allem in der Pflege so viel verdienen wie die Metaller.“ Letztere haben einen Frauenanteil von lediglich 13 Prozent. Würden beide Branchen die gleichen Erhöhungen nach den diesjährigen Kollektivvertragsverhandlungen erhalten, wäre das ein Gehaltsplus von rund 3.000 Euro pro Jahr für die Gesundheits- und Sozialberufe.
Und was hat die Coronavirus-Pandemie mit der derzeitigen Situation zu tun, mit den langen Wartezeiten, mit dem Personalmangel? Die aktuelle Krise wäre auch ohne Corona entstanden, denn sie habe schon früher begonnen, sagt Hofmarcher-Holzhacker: „Als die Pandemie kam, waren wir schon sehr müde im Gesundheitssystem. Und jetzt sind wir alle erschöpft.“ Was nun schlagend werde, sei der demografische Wandel: Viele der Beschäftigten gehen demnächst in Pension. Ebenso schwer wiegen – neben der Arbeitsverdichtung, die durch Spezialisierungen in der Medizin verstärkt wird – die Arbeitsbedingungen. Vor allem die 12-Stunden-Dienste kritisiert Hofmarcher-Holzhacker: „Diese Dienstzeiten sind für das nichtmedizinische Personal, das immerhin 80 Prozent der Beschäftigten im Gesundheitswesen ausmacht, unerträglich. Das kann man vielleicht zehn Jahre machen, dann brennt man aus.“ Die Expertin hofft, dass sich die Dienstpläne „schon aufgrund der demografischen Situation und der Attraktivierung des Berufs“ ändern.
Trotz allem ist Hofmarcher-Holzhacker überzeugt, dass die Qualität des Gesundheitssystems bei den Patientinnen und Patienten in Österreich ankommt und die Menschen zufrieden mit derBetreuungsqualität sind. Dass die Finanzierung auf bessere Beine gestellt wird, ist ihre große Hoffnung für die laufenden Finanzausgleichsverhandlungen. Ob und wie Verbesserungen gelingen, auch in der Pflege, wird man in wenigen Monaten sehen. Die Pflegerinnen und Pfleger, Ärztinnen und Ärzte und das übrige Gesundheitspersonal in Österreichs 264 Spitälern, in den Ambulanzen sowie Ordinationen werden währenddessen weiterarbeiten. Trotz Erschöpfung.
Gesundheitsreform.
2013 einigten sich Bund, Länder und Sozialversicherungsträger auf ein partnerschaftliches Zielsteuerungssystem zur Planung, Organisation und Finanzierung der österreichischen Gesundheitsversorgung. So soll die nachhaltige Finanzierung und langfristige Stärkung des Gesundheitswesens sichergestellt werden. Im Fokus steht die bessere Abstimmung zwischen den Versorgungsbereichen.
Über die Gesundheitsreform


